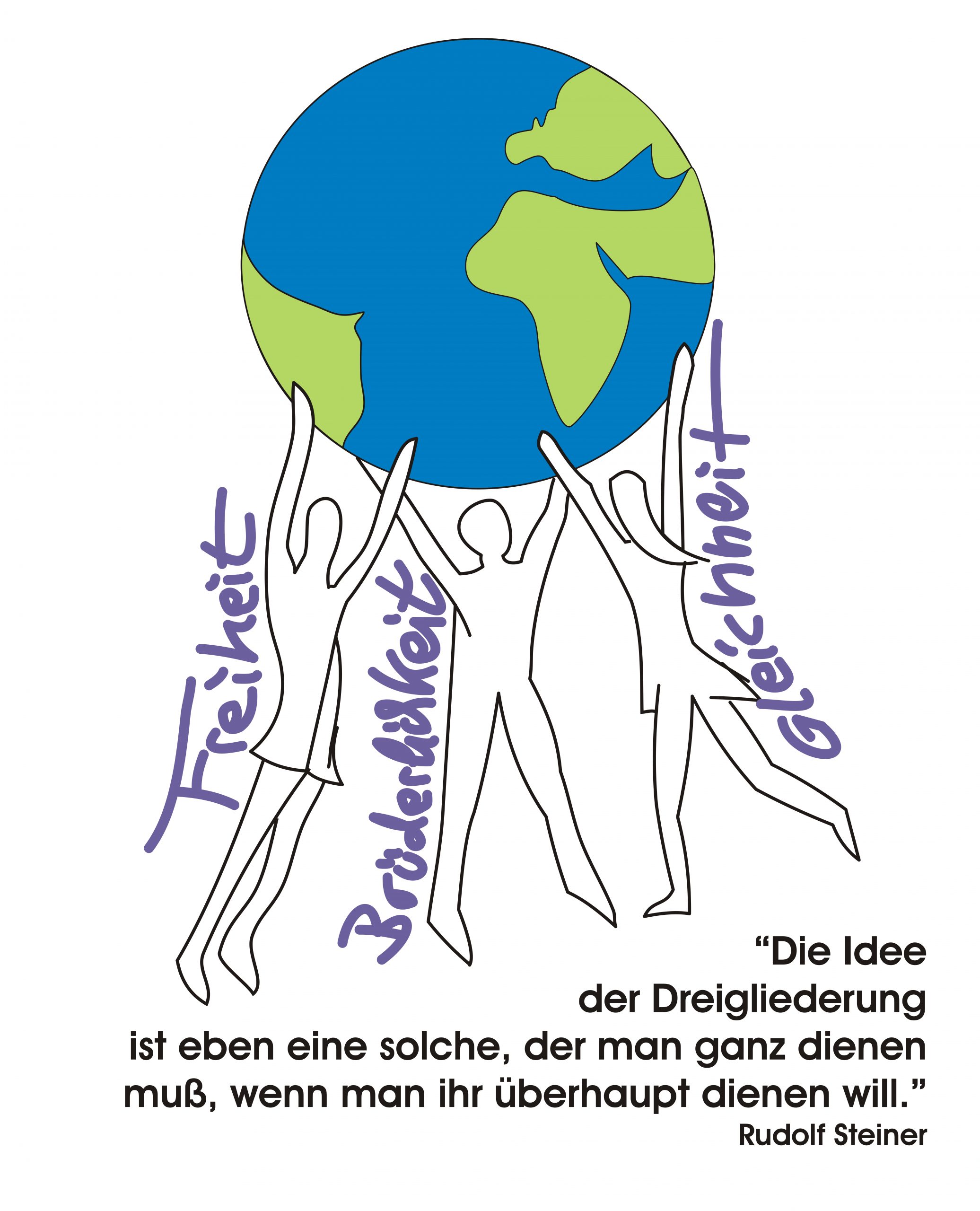Die frühgeschichtliche gesellschaftlichen und Zusammenhänge und das wirtschaftlich-soziale Leben waren bis zur ägyptischen Hochkultur geprägt durch Landwirtschaft und Selbstversorgung. Jeder produzierte das, was er für sein eigenes Leben benötigte. Priester bestimmten die Abgaben an die Gemeinschaft.
In der sumerischen Kultur beginnt der Tauschhandel, indem die Menschen ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse in den Tempel brachten, wo sie dann getauscht wurden, damit jeder mit ausreichenden unterschiedlichen Lebensmitteln versorgt werden konnte. Die Priester bestimmten in ihrer Einsicht der sozialen Verhältnisse das Tauschverhältnis. Dieses ist der Preis der Ware und hat unmittelbar Auswirkung auf die sozialen Verhältnisse: Erhält ein Bauer im Tausch nicht genügend für seine Erträgnisse, muß er u.U. anschließend Not leiden. Mit der Zeit verlagerte der Warentausch sich außerhalb des Tempels.
Das Kaufgeld
Im direkten Tausch Ware gegen Ware gibt es zwei grundlegende Probleme:
- Waren sind teilweise nur begrenzt lagerfähig (Lebensmittel)
- Tauschhandel kommt nur zustande, wenn beide Tauschpartner etwas anbieten, was der andere braucht
Um diese Begrenzung des Tauschhandels zu überwinden tauchen erste Geldformen auf, zunächst in Form von Metallstücken und -münzen aus Gold, Silber, Kupfer und sogar Eisen. Sie habe Götterköpfe oder -symbole als Prägung, später Köpfe und Wappen der Herrschaftshäuser. Das Geld steht praktisch im Tauschvorgang zwischen den Tauschpartnern, teilt diesen in zwei Teile: Waren werden gegen Geld eingetauscht, Geld wieder gegen Waren. Möglicher Tauschpartner ist nun jeder, da mit dem erlösten Geld alles gekauft werden kann. Es entfällt auch das Problem der begrenzt lagerfähigen Waren. Diese Vorteile des Geldes sorgen dann auch für eine rasante Verbreitung, Handel entsteht.
Der Erwerb einer Goldmünze durch den Verkauf von Waren war nicht wegen des Goldwertes, sondern wegen der Berechtigung, bei einem beliebigen Partner Waren zur Bedürfnisbefriedigung zu erwerben. Damit war das Geld ein „Anspruchdokument“, ein „Warenbezugs-Berechtigungsschein“, ein Rechtsdokument. Das Geld an sich hat keinen Wert, berechtigt ledigtlich zum Bezug von anderen Waren. Das Geld hatte oft zusätzlich einen Metallwert, weshalb es auch in unsicheren Zeiten als Zahlungsmittel akzeptiert wurde.
Geld war in erster Linie Kaufgeld, diente als Tauschmittel zum Kauf von Waren zur Bedürfnisdeckung. Neues Geld kam als Kaufgeld in den Umlauf, indem neu geschürfte und verbreiteten Edelmetalle zu Münzen geprägt wurden. Hierdurch konnten z.B. Kriege finanziert werden. Dass die Vergrößerung der Geldmenge zu Inflation und Verarmung eines Teiles der Bevölkerung verursachen kann, diese Erfahrung wurde schon frühzeitig gemacht, als beispielsweise in Spanien die Goldschätze von Amerika zu einer großen Ausweitung der Geldmenge führten.
Die schnelle Verbreitung des Geldes führte in den Städten auch durch den aufkommenden Handel zu Wohlstand für Mittelstand und Handwerk, während auf dem Lande der Bauernstand mehr und mehr in eine tiefe Krise geriet.
Wichtigste Grundwirkung des Geldes ist das Kaufgeld. Ein arbeitsteiliger sozialer Organismus ist existentiell darauf angewiesen, daß diese Wirkung vorhanden ist. Denn schließlich müssen die erzeugten Waren getauscht werden.
Das Kaufgeld tritt in den ursprünglichen Tauschvorgang (Ware gegen Ware) in die Mitte und teilt diesen in zwei Teile: Ware gegen Geld und Geld gegen Ware.
Daraus entstehen neue Fragestellungen:
-
Wie kann erreicht werden, daß jeder für sein Geld auch das bekommt, was er will?
-
Wie kommt es zu einem gerechten Preis?
Beide fragen gehören zusammen. In der Marktwirtschaft wird der Preis über die Menge gesteuert. Damit wird der Gerechtigkeitsanspruch an den Preis aufgegeben zu Gunsten der Konkurrenzbedingungen und des Strebens nach Gewinnmaximierung. Diese stößt jedoch an die Kaufkraftgrenze. Damit schlägt die antisoziale Wirkung wieder zurück. Wurde beim direkten Tausch die Gerechtigkeit zwischen diesen beiden Tauschpartnern durch Absprache und Übereinkunft hergestellt, ist dies beim geteilten Tauschvorgang nicht mehr möglich. Ein Bewußtsein für die soziale (oder unsoziale) Wirkung einer wirtschaftlichen Handlung ist noch nicht vorhanden.
-
Wie vermeidet man, daß der halbierte Tauschvorgang irrtümlich als Ganzheit gesehen wird?
Wenn ich ins Geschäft gehe und eine Ware erwerbe, lebe ich in dem Bewußtsein, einen vollständigen Tauschvorgang abgeschlossen zu haben: Geld gegen Ware. Das ist eine Illusion! Durch diese Vollständigkeitsillusion wird Geld selbst zur Ware. Man bildet sich ein, man würde es besitzen (habe ja schließlich hart dafür gearbeitet!) und vergißt dabei, daß es lediglich ein „Anspruchsberechtigungs-Dokument“ für den Bezug von Waren ist.
-
Wie kann man sicherstellen, dass die Geltendmachung von Ansprüchen mit dem Vorhandensein von Gütern zusammenpassen?
Geld muß man nicht sofort wieder ausgegeben. Man kann sparen für eine größere Anschaffung, zur Absicherung gegen Lebensrisiken, Kapitalbildung zur Verselbständigung usw. Durch Sparen wird die Kaufkraft-Zirkulation in Unordnung gebracht. Das Geld verläßt die Ebene Kaufgeld. Damit wird das Gleichgewicht Anspruch-Waren durcheinandergebracht und zeitlich verschoben. Dadurch, daß Geld unbegrenzt lagerfähig ist, hat es einen Vorteil gegenüber den Waren. Der dadurch verursachte soziale Schaden wird erst später und an anderer Stelle sichtbar.
Leihgeld
Durch die stürmische koloniale und später technische Entwicklung erreicht das Geld eine neue Stufe: Kreditmittel Geld.
Unternehmen sind in die Zukunft gerichtet und benötigen zweierlei:
-
Ideen und Fähigkeiten der Menschen
-
Kapital zur Vorfinanzierung
Leihgeld entsteht, schlägt die Brücke zwischen Ideen und Fähigkeiten und dem Kapitalbesitz.
Die Geldmenge begrenzt den menschlichen Tatendrang. Schrittweise wird die Golddeckung aufgehoben. Konnte bisher das Geld jederzeit noch in eine benannte Summe Gold umgetauscht werden, entfällt die jetzt (zuletzt 1971 durch die vollständige Aufhebung der Goldeinlösepflicht durch die USA). Geld wird nun endgültig zu einem reinen Rechtsdokument ohne realen Gegenwert. Die Geldmenge wird hoheitlich durch die Notenbanken verwaltet.
Neues Geld kommt inzwischen nur noch auf dem Kreditwege in den Wirtschaftskreislauf. Gleichzeitig entsteht dadurch Kaufkraft, und die Produkterzeugung wird angefacht.
Durch das Aufkommen des „Giralgeldes“ (Buchgeld) verläßt das meiste Geld physikalisch garnicht die Bank. Damit wird das Kreditvolumen grenzenlos. Diese „Kreditschöpfung“ wird heute lediglich begrenzt durch das im Umlauf befindliche Bargeld und die von der Bundesbank festgelegten Mindestbargeldreserve der einzelnen Bank. Über den Prozentsatz der Mindestreserve versuchen die Notenbanken, die Geldmenge zu steuern. Dies ist ein erster Schritt in Richtung einer bewußten Grenzziehung.
Durch die Entwicklung des Leihgeldes in den verschiedensten Formen (z.B. Aktien) entstand eine ungeheure Produktivität der Unternehmer und ein damit verbundenes Wachstum der Wirtschaft und allgemeiner Wohlstand für den größten Teil der Bevölkerung. Die soziale Gerechtigkeit als Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handelns geriet dabei völlig aus dem Blick. Löhne als „Preis für die Arbeit“ sind Produktionskosten, und daher möglichst gering zu halten!
Schenkungsgeld
Die Regelung der Sozialen Ordnung wurde zur Zeit der Tauschhandelsgesellschaft im Tempel durch die Priester geleistet. Diese bestimmten auch die Abgaben für die Gemeinschaft. Durch das Aufkommen des Geldes ging diese Zug um Zug in die „öffentliche Hand“ über. Dies aber hauptsächlich deswegen, weil sich sonst keiner zuständig fühlte für diese soziale Ordnung. Von der öffentlichen Hand wurde diese aber nur als eine Art „Mindest-Ordnung“ betrieben: unterste Grundlage einer (gerade noch) menschenwürdigen Existenz.
Schon um die vorletzte Jahrhundertwende entstand auch im Volk ein „soziales Gewissen“. Unternehmer versuchten, ihre Betriebsgemeinschaften und ihr Umfeld auf eine gerechte Basis zu stellen (Krupp, Siemens, Owen, Weleda …), im Genossenschaftswesen sollten Arbeiter selbst in den Unternehmerstatus treten oder Solidargemeinschaften bilden, die politische Weltanschauung des Sozialismus entstand.
Wie erreicht man, daß jeder Bürger genügend Geld (Kaufgeld) für die Befriedigung seiner Bedürfnisse erhält? Die Lohnfrage wird zur Verteilungsfrage: Welchen Anteil erhält jeder einzelne vom gemeinsam Erwirtschafteten? Auf der anderen Seite können die Betriebe ihre Erzeugnisse nur verkaufen, wenn ausreichend Konsumenten auch über ausreichend Kaufgeld verfügen. Dieser Aspekt wird oft übersehen.
Ziel des Wirtschaftslebens kann doch nur die Steigerung der Lebensqualität aller Beteiligten sein. An dieser Stelle wird deutlich, daß das Wirtschaftsleben nur als zusammenhängendes System gedacht werden kann. Alle Beteiligten sind eng miteinander verknüpft und voneinander abhängig.
Im Denken sind wir noch weit davon entfernt: Lohnkosten werden als Teil der Produktionskosten gedacht, nicht als Ertragsverteilungsproblem. Und sogar die „Sozialkosten“ (Steuern und Abgaben) erleben wird als Ertragsschmälerung. Es ist aber der Anteil aus der Ertragsverteilung für Kinder, Alte, Kranke und Behinderte, die nicht am Produktionsprozeß teilnehmen können. Diesem Personenkreis steht ein Anteil zu, wir erleben es aber ebenfalls als „Kosten“. Die Empfindung ist in bezug auf die „Gewinne“ ähnlich verschoben: Gewinn wird als Eigentum des Unternehmers und dessen Erfolg empfunden. Eingesparte Lohnkosten schlägt er ebenfalls auf seinen Gewinn auf. Und da es in der Natur der Sache liegt, Gewinne zu mehren, werden Arbeitsplätze eingespart zu Gunsten des Gewinns. Die Arbeitsfrage wird hier auch zum Verteilungsproblem: den Gewinn beansprucht der Unternehmer für sich alleine und beklagt sich über die steigenden Soziallasten (u.a. wg. Arbeitslosigkei).
Beim Leihgeld beobachten wir inzwischen eine Umorientierung: Stichwort „Social Investment“, Sparer fragen zunehmend danach, was mit dem Geld geschieht und wollen Einfluß darauf nehmen.
In der Freizeit, im kulturellen und sozialen Leben werden im Gegensatz zum Wirtschaftsleben Werte verbraucht, ohne daß ein Gegenwert entsteht. Hier wird ein handfester wirtschaftlicher Wert (Geld) gegen einen luftigen seelisch-geistigen eingetauscht. Wenn ich z.B. ein Buch kaufe, entrichte ich zwar einen „Kaufpreis“, erhalte dafür jedoch etwas rein Geistiges.
Man kann also hier von Schenkungsgeld sprechen, denn bei einer Schenkung erwarten wir keine direkte Gegenleistung. Alle Zahlungen in das Geistesleben sind hier Schenkungen. Sie richten sich in die Zukunft: eine „Investition“ in Bildung oder Forschung wird ihre Wirksamkeit erst in der Zukunft zeigen.
Inflation und Deflation
Im Gegensatz zum direkten Gütertausch wird der Gegenwert des Geldes erst bei der Ausgabe sichtbar. Wieviel reale Güter und Leistungen man für eine bestimmte Summe erhält, bestimmt die Kaufkraft des Geldes: diese ändert sich mit jeder Preisänderung. Für den einzelnen kann eine solche Preisänderung erhebliche Auswirkungen haben. Geldwirtschaftlich werden diese Änderungen erst relevant, wenn sich das ganze Preisniveau ändert. Um dies festzustellen, wird an Hand einer fiktiven „typisch Deutschen Durchschnittsfamilie“ mit „typischem“ Lebensmuster der Verbrauch statistisch konstruiert. Die prozentuale Veränderung der „Lebenshaltungskosten“ gilt als die populärste Teuerungs- bzw. Verbilligungsrate. Der langfristige Trend der Nachkriegszeit zeigt deutlich eine Inflation: mit dem Schweizer Franken aus dem Jahre 1939 kann man heute nur noch 25% der damaligen Gütermenge kaufen. Das entspricht einer teuerung der Preise um 400%!
Als Ursache kann man mehrere Gründe nennen, weshalb die volkswirtschaftliche Definition, daß dann die Geldmenge größer als die Produktmenge sei, das Phänomen nur unzureichend beschreibt. Haupsächlicher Grund ist der im Kapitalismus verankterter Wachtumszwang, der immer wieder die Preise in die Höhe treibt. Auch die Gier zeigt sich in stndig steigenden Mieten und Pachten: Es wird genommen, was der ‚Markt‘ hergibt.
Auswirkungen der Inflation sind je nach Bereich unterschiedlich. Im Kaufgeldbereich sind die Auswirkungen eher gering, da Löhne inzwischen meist schon an einen Index gekoppelt sind und auch relativ zeitnah wieder ausgegeben werden. Ein Monatslohn wird im Laufe eines Monats ausgegeben, ein Jahreseinkommen im Laufe eines Jahres. Ähnliches gilt für die Preise.
Anders verhält es sich im Bereich des Leihgeldes. Ein Vermögen, über Jahre festgelegt, würde von der Inflation nach und nach verzehrt. Daß man sich dagegen wehrt, erscheint verständlich. Eine Art des Wehrens ist die Forderung nach Erhöhung der Zinsen. In diesem Zusammenhang wird immer mehr mit der Realverzinsung gerechnet, also Zinsen abzüglich Preissteigerung. Gegenpohl nehmen die Schuldner ein. Ihr Vermögen ist negativ. Inflation bedeutet für sie, daß die Schulden zwar auf dem Papier gleich bleiben, real aber immer weniger wert sind.Am meisten betroffen ist der Schenkungsgeldbereich, da er ständig höhere Einkommen fordern muß, ohne einen adäquate Gegenwert zu bieten. In Zeiten steigender Preise wird das Geld festgehalten oder zum Verzehr benötigt.
Das Sparen
Früher wurde für schlechtere Zeiten ein Vorrat angelegt. Das war natürlich nur begrenzt möglich. Heute sparen wir Geld für alles mögliche. Wenn eine allgemeine Versorgungskriese ausbrechen sollte, nutzt uns dieses gar nicht. Es würde höchstens die Preise inflationär in die Höhe treiben. Geld hat seine Sicherheitsfunktion nur, wenn der soziale Organismus als Ganzer intakt ist.
Von der volkswirtschaftlichen Zirkulation her betrachtet bedeutet Sparen einen Stau des Zirkulationsprozesses. Ein Teil des Einkommens wird nicht mehr für den Kauf ausgegeben. D.h., ein Teil meiner Ansprüche auf Waren wird für die Zukunft zurückgehalten. Die Zirkulation gerät ins Stocken. Ein Teil des Geldes fließt nicht mehr zurück in den Produktionskreislauf, wo es eigentlich benötigt würde. Die Produktion muß darauf entweder mit einem mengenmäßigen Rückgang oder mit Produktivitätssteigerung mit dem Ziel der Kostenreduzierung reagieren, was zu einem geringeren Geldeinkommen führt. Denkt man diesen Wechselprozeß weiter, dann zeigt sich, daß das Nicht-Teilnehmen des Spargeldes an der Zirkulation diese und damit die ganze arbeitsteilige Wirtschaft zum Stillstand bringen würde.
Natürlich kann ich „mein“ Geld sparen, es gehört ja mir. Und darin liegt ja der Vorteil des Geldes, dass ich es beliebig aufbewahren kann. Allerdings verschleiert dies die Tatsache, dass der Gegenwert an Waren nicht auf einem Speicher liegt, sondern neu produziert werden muß. Das Sparen bringt den sozialen Organismus gleich zweimal in Bedrängnis: Durch die heute nicht abgerufenen Waren, die unverkauft liegen bleiben, und in der Zukunft bei den zusätzlich abgerufenen Waren, welche erst produziert werden müssen.
Modernes Geld ist nur noch ein Anspruchstitel, ein Anrecht. Sparen heißt, das Recht auf Warenbezug nicht ausüben. Nicht ausgeübte Rechte aber müssen in bestimmter Frist verfallen, da sonst der soziale Organismus unter der Bedrohung sich anhäufender möglicher Vergangenheitsansprüche erdrückt wird. In vielen Lebensbereichen ist dies auch heute schon Praxis. So verfallen im Geschäftsverkehr Forderungen aus realen Leistungen, wenn sie einige Jahre nicht beansprucht werden. Gespartes Geld ist nicht ausgeübtes, nicht geltend gemachtes Recht! Müßte nicht auch gespartes Geld nach einiger Zeit verfallen?
In Ulm sowie in anderen deutschen Städten gab es im Mittelalter um ca. 1400-1500 n.Chr. eine Währung, die regelmäßig verfiel bzw. immer nur eine begrenzte Zeit gültig war. Sie mußte entweder in einer bestimmten Zeit ausgegeben werden, oder konnte mit einem erheblichen Verlust zurückgegeben werden. Dies ist u.a. der Grund dafür, daß in einer verhältnismäßig kleinen Stadt wie Ulm ein so großes Münster entstehen konnte. Auch erlebte die Stadt durch diese Verfallwährung eine große wirtschaftliche Blütezeit.
Sonderbare Wirkungen gestauter Gelder
In sog. „Anlegermodellen“ werden heute riesige Geldmengen in Bewegung gesetzt. Dabei handelt es sich ausschließlich um „gestaute“ Spargelder. Beispielsweise sind vor vielen deutschen Städten auf der grünen Wiese große Einkauft-Center entstanden, die meist solch ein Anlegermodell sind. Oder viele der Freizeit- und Erlebnisbäder. Oder auch größere Siedlungsbauprojekte.
Was geschieht da? Erst einmal könnte man anführen, daß das gesparte Geld wieder zurückgeführt wird in den Kreislauf. Das stimmt. Aber es wurde in der Zwischenzeit der sozialen Kontrolle durch den einzelnen entzogen, zu Gunsten der marktwirtschaftlichen Interessen einer anonymen Organisation. Und dieses Interesse ist vor allem eines: Rendite zu erwirtschaften. Zusätzlich wurde das Geld aus der Anspruchsberechtigung des Kaufgeldes herausgebracht und zum Leihgeld. Die sozialen Auswirkungen sind verheerend: nicht nur kleine Einzelhandelsgeschäfte werden in ihrer Existenz bedroht, auch mittlere Supermärkte können gegen diese „Einkaufszentren“ nicht bestehen, Innenstädte verwaisen. Alle Konsequenzen dieses „Strukturwandels“ sind noch gar nicht abzusehen!
Bei der Markteinführung der Telekom-Aktie wechselten innerhalb weniger Tage 40 Millionen DM den Besitzer. Es war nicht einmal das Geld von Großanlegern, sondern hauptsächlich das der „kleinen Sparer“. Noch vor der Freigabe ist der Wert um mehr als das Doppelte gestiegen. Wo kommt dieses Geld her, was den Wert steigert?
Zins und Zinseszins
Neben den o.g. Vorteilen, welche Geld hat im Zirkulationsprozeß, und neben all den sozialen bzw. unsozialen Auswirkungen, die ein unbewußtes oder falsches Umgehen mit Geld bewirken, wurde das Sparen auch noch belohnt: wir erhielten einen Zins. Diese Tatsache, ob wir heute einen Zins erhalten oder bezahlen, ist eine Selbstverständlichkeit und bewegt die Gemüter nicht. Doch die Entwicklung sollten wir einmal etwas genauer betrachten.
Zinsen zu erheben, war ursprünglich verboten. Im Buch Moses steht: „Du sollst dem anderen Menschen dein Geld nicht auf Zins leihen.“ Dreitausend Jahre Geschichte wurden geprägt durch diesen Ausspruch. Auch die meisten griechischen Philosophen, allen voran Platon und Aristoteles, haben das Zinsen nehmen auf das allerschärfste verdammt – wie dann auch viele griechischen und später christliche Schriftsteller bis in das Mittelalter hinein. Wenn sie ein großes Lexikon, etwa das Theologische Lexikon der katholischen Kirche, aufschlagen, dann steht da unumwunden: Eigentlich ist dieser Satz immer noch gültig. Weil aber die katholische Kirche auch Banken betreibt und Geldgeschäfte macht, hat sie eine interessante Formel gefunden: Man darf insofern Zinsen erheben, als man Kosten hat durch das Verwalten und Ausleihen der Gelder.
In den gleichen Büchern Mosis steht weiter: „Von Fremden aber darfst du Zinsen nehmen.“ Deshalb war es den Juden erlaubt, Zinsen zu nehmen, während es bei den Christen verboten war. Dies war u.a. dann auch die Grundlage dafür, daß mit der Familie Rothschild ein neues Bankwesen entstand.
Inzwischen werden keine Zinsen mehr gezahlt, ja teilweise sogar Negativzinsen erhoben. Das ist keine ‚Geldpolitische Maßnahme‘, wie oft behauptet wird, sondern schuldet allein der Tatsache, dass einfach viel zu viel Geld vorhanden ist. Zinseszinz und Spekulation haben die Buchgeldmenge um ein Vielfaches der Menge aufgebläht, was eine Volkswirtschaft noch an Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stellen kann. D.h., diesen riesigen Buchgeldsummen stehen keine realen Menschen mehr gegenüber, die eine Leistung erbringen können. Unser Warenbezugsberechtigungsschein (siehe oben) hat seinen Wert verloren.
Geld als Ware
In jeder Sekunde werden mit Hilfe elektronischer Datenübertragung dreihundert Milliarden Dollars über die Erde hin und hergeschoben. In dieser riesigen Geldbewegung wird Geld als Ware gehandelt: Dollars werden gekauft und verkauft oder umgewechselt in andere Währungen. Gelder, welche zur Bedürfnisdeckung nicht mehr „gebraucht“ werden, sammeln sich über die Jahrhunderte auf Banken an. Sie wurden ihrem ursprünglichen Zweck – zum Erwerb von Waren – enthoben durch die Tatsache, daß sie dazu eigentlich nicht mehr benötigt werden. Eigentlich würden sie nun „Zwecklos“ herumliegen. Da sie aber aus einem sozialen Wirtschaftsprozeß stammen, entwickeln sie Eigendynamik:
Geld wird zur Ware, welche gekauft und verkauft wird und, später dann, sogar anfängt „zu arbeiten“ und selbst Geld zu verdienen. „Ruhen sie sich aus und lassen sie ihr Geld arbeiten.“ Dieser Werbespruch steht auf vielen Prospekten von Banken. Das alles beruht auf einer großen Illusion. Sie entsteht an der Stelle, wo wir in unserer Empfindung den Verkaufsvorgang schon als Ganzes empfinden, obwohl es eigentlich nur eine Hälfte des Tauschvorganges ist. Diese Illusion überträgt sich darauf, daß wir Geld als Ware nehmen und anschließen annehmen, es könnte sogar arbeiten. Geld ist aber nur ein Rechtsdokument: die Berechtigung zum Erwerb von Gütern und Leistungen. Und eben solch ein Rechtsdokument ist weder eine Ware, noch kann es arbeiten! Die sozialen Folgen dieser Illusion können wir überall in unserer Gesellschaft erkennen.
Perspektiven – Ausblicke auf die Zukunft
Geld hat die Ebene des Realen längst verlassen. Unser gesamter Geldverkehr ist im Zeitalter des bargeldlosen Zahlungsverkehrs nur noch eine große Buchhaltung. Der oberste Grundsatz der doppelten Buchführung lautet: Keine Buchung ohne Gegenbuchung!
Wir müssen langsam begreifen, daß jede wirtschaftliche Handlung irgendwo ihre Gegenbuchung hat: Wo an der Börse mit Spekulation Geld verdient wird, zahlt jemand dafür; wo sich jemand egoistisch bereichert, da entsteht am anderen Ort Armut; wo Umwelt „verbraucht“ wird, entsteht irreparable Zerstörung. Die dadurch ausgelösten Folgen schlagen langfristig auf die Verursacher zurück.
Nachdem ich versucht habe, ein wenig die Geldprozesse bewußt zu machen, haben wir die Grundlage geschaffen dafür, dem Geld seine sozial schädliche Wirkung zu nehmen. Besinnen wir uns auf die eigentliche Funktion des Geldes zurück besteht nicht mehr die Gefahr, daß wir auf die Illusion hereinfallen, Geld wäre eine Ware oder könnte arbeiten. Als nächsten Schritt können wir versuchen, diese neuen Erkenntnisse in unser wirtschaftliches Handeln einfließen zu lassen.
Ist es möglich, dem Geld seinen „Scheincharakter“ zu nehmen? Tauschringe versuchen seit vielen Jahren, einen neuen Weg zu gehen. Regiogelder versuchen, Geld auf seine eigentliche Funktion zurückzubringen und mit einer Entwertung zu versehen, damit das Geld gleichberechtigt zu den Waren einem Verfall unterliegt.
Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wozu wir wirtschaften und was Wirtschaft wirklich ist, können wir uns zum Schluß auch die Frage stellen, ob wir Geld wirklich brauchen, um allen Menschen ein glückliches und zufriedenes Auskommen zu ermöglichen.
In Deutschland produzieren wir beispielsweise in den letzten Jahren ca. 1,4 mal soviel Nahrungsmittel, wie wir zur Ernährung aller brauchen würden. D.h., wir haben kein Problem der Menge, sondern wir haben ein Verteilungsproblem! Brauchen wir zur Verteilung unserer Erträgnisse noch das Geld, oder können wir menschlichere Methoden entwickeln?
Zur Entwicklung des Geldes gibt es einen sehr guten Film, der die Fehlentwicklungen und deren soziale Auswirkungen deutlich macht. Er besteht aus 3 einzelnen Filmen, die zusammengehören: