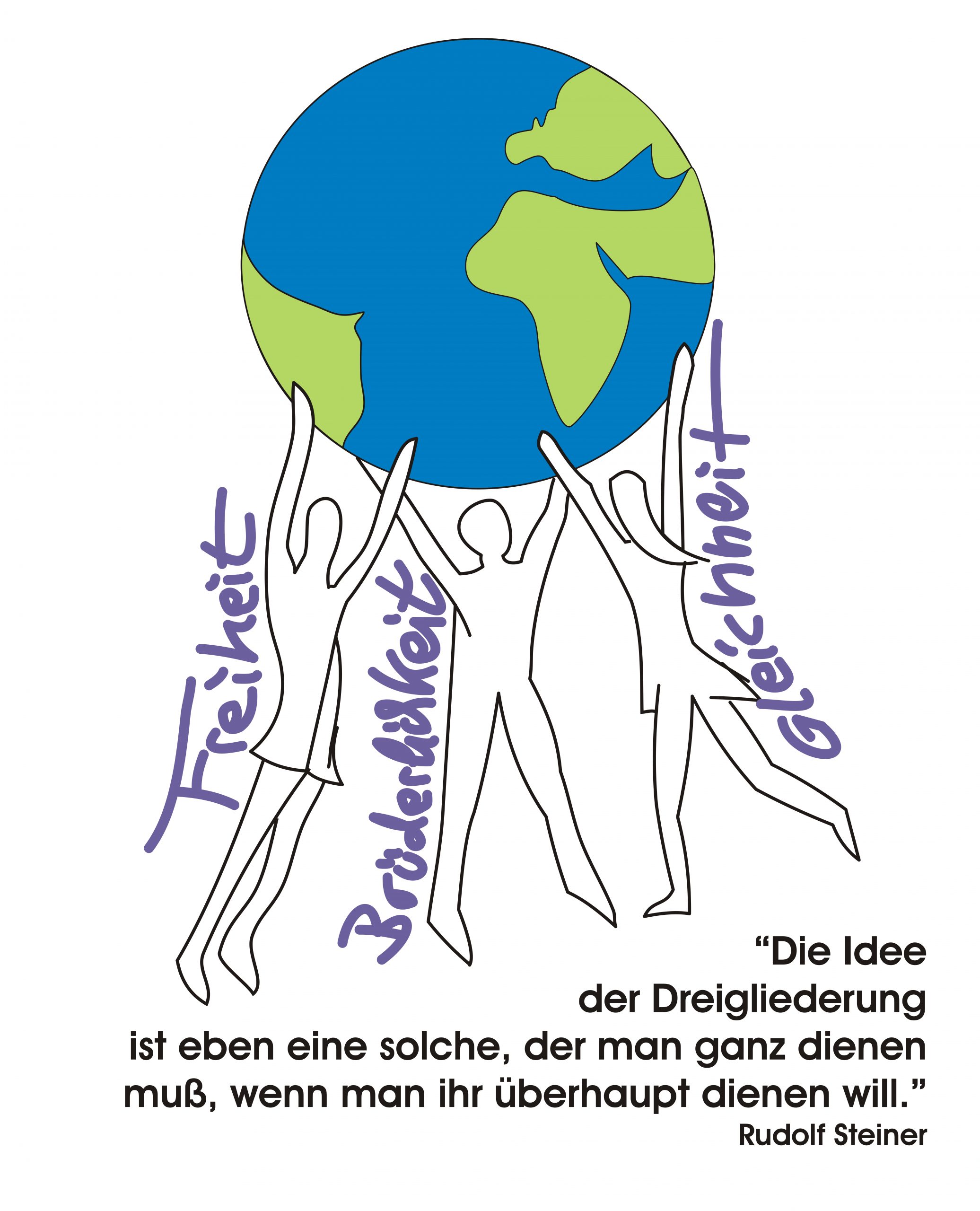Bei meiner Mithilfe, Zukunftsperspektiven für die Städte Leipzig und Rom zu entwickeln, musste ich immer wieder feststellen, wie weit auch fortschrittliche Beamte sich von den natürlichen Realitäten entfernt haben. Es besteht kaum noch ein Bewusstsein und damit eine Verantwortung gegenüber dem Ursprung der vielen Lebensgrundlagen, welche die Natur aus dem Umland zur Verfügung stellt.
Nicht nur die Lebensmittel kommen vom Land, sondern auch die frische Luft, das Wasser, die Energie und die Rohstoffe. Auch die Erholung wird auf dem Land gesucht. Der Druck auf die Landschaft wächst parallel mit dem Bedürfnis nach größeren Wohnungen, nach mehr Autos und damit nach mehr Straßen und Gewerbegebieten.
Und was wird dem Land zurückgegeben? Müll, Abwasser, Abgase, Lärm, durch die Pendler verstopfte Straßen usw. Natürlich werden auch Wirtschaftsgüter, Dienstleistungen, Kultur usw. an das Umland abgegeben. Aber jeder könnte sich einmal fragen, inwieweit diese Leistungen direkt oder indirekt dem Land, bzw. der Natur wieder nutzbringend zugutekommen. Gibt es einen Ausgleich? Helfen die Schulen oder Universitäten, ein verantwortliches „Umlandbewusstsein“ zu vermitteln?
Inwieweit setzen sich die Behörden oder Medien für diesen Ausgleich ein? Helfen die vielen Kulturaktivtäten, die Menschen für diese Fragen zu sensibilisieren?
Bei dieser Distanz zu den Bedürfnissen der Natur frage ich mich, wieso dann auch noch die Landwirtschaft von der Stadt aus mit aufgeblähten Behördenapparaten und Kontrollorganen regiert wird. Die Hälfte des landwirtschaftlichen Budgets verschwindet in diesen Wasserkopf. Nur die andere Hälfte bekommen die Landwirte zugeteilt, jedoch zu den merkwürdigsten Bedingungen, die ihnen viel bürokratische Arbeit abverlangen und nur zu einem kleinen Teil der Gesundung von Boden und Natur zugutekommen.
Allen, der Natur, den Bauern und den Konsumenten, würde es besser gehen, wenn fast alle dieser Gelder bei den Steuerzahlern bleiben würden und wir dadurch auch ohne weiteres reale Preise für eine ökologisch gesund erzeugte Nahrung zahlen könnten.
Bei meinen Arbeiten mit Behörden musste ich auch immer wieder feststellen, dass nicht nur das Bewusstsein für das Land fast ganz fehlt, sondern auch das gegenseitige Bewusstsein vom einen Menschen zum andern sehr eingeschränkt ist. Man weiß voneinander kaum etwas und gemeinsam erarbeitete Ziele gibt es so gut wie gar nicht. Für die Entwicklung von gemeinsamen Visionen musste ich mühevoll immer wieder die verschiedenen Behörden an einen Tisch bringen. (Wenn die offizielle Arbeitszeit zu Ende ging, ließ allerdings das Interesse bei vielen nach.)
Ein Stadtorganismus leidet heute an vielen sozialen, ökonomischen, logistischen und ökologischen Krankheiten. Wie bei einem kranken Menschen reicht es auch bei einer Stadt nicht, nur auf die inneren Probleme zu schauen. Die inneren Probleme haben immer auch mit dem Verhältnis zur Außenwelt zu tun. Zur Heilung muss diese Wechselwirkung zwischen innen und außen ganz praktisch ins Bewusstsein rücken.
Wie groß ist denn konkret der Außenraum einer Stadt? Im Durchschnitt kommen auf jeden europäischen Bürger ca. 5000 m 2 (1/2 ha) Land (Wald, Landwirtschaft, Häuser, Straßen usw.). Für eine Region z.B. mit einer halben Million Einwohnern sind dies eine viertel Million ha =2500 km2. Dies entspricht einem Radius von 28 km um einen Stadtkern. Für dieses Gebiet müssten sich, bei richtigem Bewusstsein, die Menschen verantwortlich fühlen. Natürlich kann dies nur als Richtschnur dienen, weil ja andere Städte angrenzen, aber dafür gibt es auch weniger besiedelte Landstriche, die dann mit in die Verantwortung genommen werden können. Jedenfalls bedeutet dieses Hinausgehen mit dem Bewusstsein, dass sich eine neue Beziehung zu dem Umfeld aufbauen kann. Eine Beziehung, die nicht nur vom Nehmen lebt, sondern auch direkt oder indirekt etwas zurückgibt.
Sind nicht die meisten von uns mittlerweile Städter? Auch die auf dem Land lebenden Menschen können sich fragen, inwieweit sie einfach nur das Land, die Natur benutzen und wieweit sie dieser etwas zurückgeben.
Bei der konventionellen Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung werden heute in erster Linie wirtschaftliche, das heißt, Konsumgesichtspunkte berücksichtigt. Im Mittelpunkt steht dabei das Auto, für das der größte Teil der Stadtflächen durch Straßen und Parkplätze herhalten muss. Schließlich soll man ja bequem von zu Hause ins Einkaufszentrum, zur zentralisierten Arbeitsstelle oder in den Freizeitpark kommen können. Die sozialen und kulturellen Entwicklungspotentiale des Menschen oder die aufbauende und artenreiche Natur werden bei der Planung selten berücksichtigt.
Dabei gibt es heute Möglichkeiten Orte zu realisieren, in denen der Mensch mit all seinen Kapazitäten sich wieder körperlich, sozial und kulturell gesund entwickeln könnte. Z.B. kann man grüne Orte für mehrere Generationen bauen, in denen mehr Energie erzeugt als verbraucht wird. Dazu müssten wir allerdings unsere Lebensgewohnheiten ändern. Zur Planung solcher Orte bzw. zur Umgestaltung der bestehenden Strukturen müssten die konventionellen Spezialisten aber lernen, sich zu öffnen und mit neuen sozialen, ökologischen, energetischen und kulturellen Spezialisten zusammenarbeiten, um einen Gesamtplan zu entwickeln, der u.a. auch die umgebende Landschaft inklusive der Landwirtschaften mit einbezieht. Damit zukunftsgerichtete Planungen auch Erfolg haben, muss die beteiligte Bevölkerung in den Prozess unbedingt mit einbezogen werden. Siehe auch das Kapitel „Regionalentwicklung mit Hilfe von Zukunftswerkstätten“.
Für mich besteht bei solchen Planungsprozessen immer das Ziel, einem gesunden „Stadt- bzw. Dorforganismus“ näherzukommen. Hierzu gehört eine sich gegenseitig stimulierende Vielfalt mit lokalen, gemeinnutzfördernden Arbeitsplätzen, Schulen, Geschäften usw., mit weltoffenen, sozialen, kulturellen und generationsübergreifenden Begegnungsmöglichkeiten, mit pflegerischen und medizinischen Versorgungsmöglichkeiten, mit energiearmen bzw. energieneutralen Häusern und Infrastrukturen sowie einem starken ökologischen Netz, welches sich vom Landbiobauern bis auf die bepflanzte Dachterrasse in der Stadtmitte hinzieht. Unter dem Strich heißt es, einen Rahmen zu entwickeln, in dem ein „natur- und menschenfreundliches Leben mit kurzen Wegen“ möglich ist.
Änderungen werden heute in der Regel erst einmal von unten her initiiert werden müssen. Dazu können wir z.B. mit vielen kleinen Aktionen die Natur wieder in unsere Dörfer und Stadtteile holen. Brachflächen, Vorgärten, Dächer und sogar Fassaden können begrünt und auch für Gemüseanbau genutzt werden. So erfahren zurzeit die Familien- und Schrebergärten wieder eine Neubelebung. Außerdem kommen ständig neue Stadtgarteninitiativen hinzu, die nicht nur für essbare Begrünung sorgen, sondern auch durch soziale Aktivitäten zu einem neuen Lebensgefühl in unseren Städten beitragen. Dies ist sehr wichtig, denn schließlich werden auch in Zukunft die meisten Menschen in den Städten wohnen.
Durch Verzicht auf oder die gemeinsame Nutzung von Autos könnten unsere Orte zusätzlich viel natürlicher gestaltet werden. Jedes Fahrzeug braucht ja nicht nur 3×12 m 2 Parkplatzfläche (zu Hause, Arbeitsplatz, Einkaufszentrum usw.), sondern hat auch noch einen Anteil von über 200 m 2 Straßenfläche!
Auch könnten wir konkret helfen, einen Freundeskreis aufzubauen, der eine Verbindung zu einer nachhaltigen Landwirtschaft im Umland pflegt. Dieser Kreis könnte z.B. den Landwirten und Gärtnern die laufenden Bewirtschaftungskosten garantieren und dafür im Gegenzug die gesunden Lebensmittel geschenkt bekommen. Eine neue soziale Stadt-Land-Verantwortungskultur kann so konkret entstehen, in der alle Beteiligten, besonders die Kinder, „neue Welten“ miteinander entwickeln. Diese Form der sogenannten „Community Supported Agriculture“ oder „Solidarische Landwirtschaft“ entsteht nun schon mit immer mehr Höfen. Es lohnt sich, diese ausfindig zu machen, um von ihnen zu lernen und neue aufzubauen.
Aus: „Jeder kann die Zukunft mitgestalten“ von Uwe Burka (LINK)